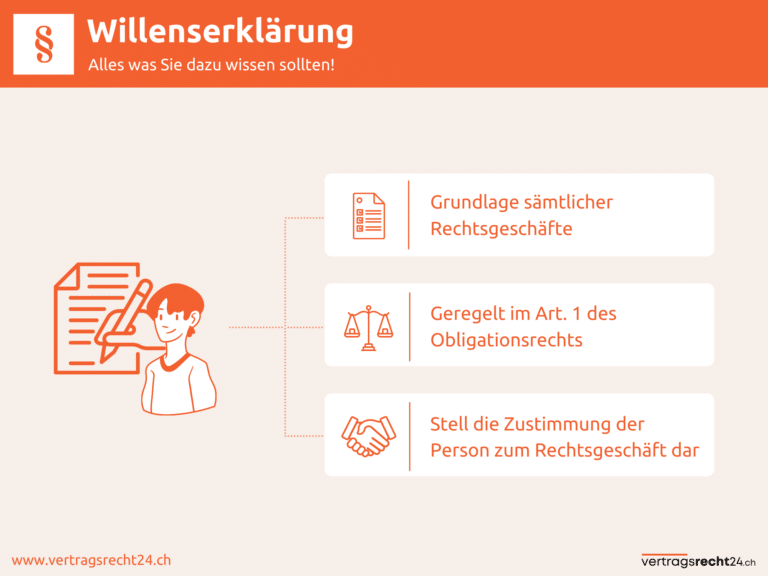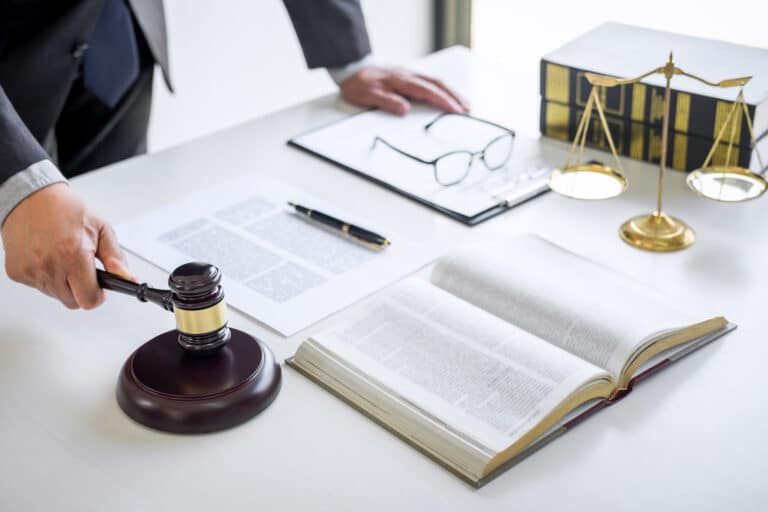Willenserklärung § Definition, Arten & Auslegung
- Redaktion
- Lesezeit: ca. 12 Minuten
- Teilen
- 28 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.
- Das Wichtigste in Kürze
- Zwei übereinstimmende Willenserklärungen führen den Vertragsschluss herbei.
- Es handelt sich um die Äußerung eines persönlichen Willens, der sich aus Erklärungswille, Handlungswille und Geschäftswille zusammensetzt.
- Bei mehrdeutigen Willenserklärungen muss der wahre Wille durch die Auslegung ermittelt werden.
- Eine Willenserklärung muss abgegeben und anschliessend beim Empfänger zugehen.
Was ist eine Willenserklärung?
Die Willenserklärung bildet die Grundlage für sämtliche Rechtsgeschäfte, die geschlossen werden. Die rechtliche Begründung dafür findet sich in Art. 1 OR. Es handelt sich nach der allgemeinen Definition um eine Willensäusserung, die auf die Erzielung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Bedeutet: Sie erklären, dass der Abschluss eines bestimmten Rechtsgeschäfts Ihrem Willen entspricht. Ein Vertrag wird nämlich erst dann wirksam, wenn beide Vertragsparteien eine übereinstimmende Willenserklärung abgegeben haben. Willenserklärungen sind im Rechtsverkehr allgegenwärtig und bilden die Grundlage für jeglichen Vertragsschluss. Die Willenserklärung spielt beispielsweise bei den folgenden Geschäften eine Rolle:
- Abschluss eines Kaufvertrags (z. B. Kaufvertrag Auto oder Kaufvertrag Motorrad)
- Errichtung eines Testaments
- Einstellung eines Mitarbeiters über einen Arbeitsvertrag
- Schenkung über einen Schenkungsvertrag (z. B. Schenkungsvertrag Immobilie)
- Ausschlagung eines Erbes
- Beauftragung eines Handwerkers über einen Werkvertrag
Die Willenserklärung lässt sich dabei in zwei Aspekte untergliedern: Der innere Wille – was möchte die Person tatsächlich erklären? und der äusserlich erkennbare Wille – was sagt die Person tatsächlich? Damit ein Vertrag nachhaltig wirksam geschlossen werden kann, muss der innerliche Wille und das Erklärte übereinstimmen. Die Willenserklärung ist vom sogenannten Realakt abzugrenzen. Ein Realakt liegt vor, wenn eine Handlung unmittelbar zu einer Rechtsfolge führt und diese unabhängig vom Willen der Person eintritt.
Die drei Elemente einer Willenserklärung:
Der Wille einer Person lässt sich wiederum in drei Komponenten aufteilen. Wenn alle drei “Arten des Willens” vorliegen, ist davon auszugehen, dass der Wille, der erklärt wurde, sich fehlerfrei und vollständig gebildet hat. Die Willenserklärung wird damit verbindlich und kann nur noch unter bestimmten Voraussetzungen über eine Anfechtung angegriffen werden. Im Rechtsverkehr ist mithin Vorsicht geboten, was wie geäussert wird. Die drei Elemente des Willens sind:
- Erklärungswille: Der Erklärungswille zeichnet sich dadurch aus, dass die Willenserklärung abgegeben wird, in dem Wissen, dass dadurch eine Rechtswirkung erzielt wird.
- Geschäftswille: Der Geschäftswille besteht immer dann, wenn die Handlung bzw. Erklärung in dem Wissen und Wollen abgegeben wurde, dass eine Rechtsfolge erzielt wird. Sie müssen also ein bestimmtes Rechtsgeschäft durch Ihre Erklärung herbeiführen wollen.
- Handlungswille: Der Handlungswille beschreibt den Willen überhaupt tätig zu werden bzw. eine Erklärung abgeben zu wollen. In den meisten Fällen ist dieser Punkt unproblematisch. Lediglich bei Personen, die hypnotisiert sind oder im Schlaf sprechen, kann es an Handlungswille mangeln.
Arten der Willenserklärung
Es gibt unterschiedliche Wege seinen Willen zu erklären. In der Rechtspraxis haben sich die folgenden Arten der Willenserklärung etabliert. Man unterscheidet grundsätzlich immer zwischen unmittelbaren und mittelbaren Willenserklärungen. Unmittelbar ist die Willenserklärung dann, wenn der Erklärende dem Empfänger direkt seinen Willen mitteilt. Meist handelt es sich um eine mündliche Erklärung. Die mittelbare Willenserklärung ist dann einschlägig, wenn der Wille unter Abwesenden erklärt wird. Hier erfolgt die Erklärung in Form eines Briefes oder einer Botschaft, die durch einen Dritten überbracht wird.
Ausdrückliche Willenserklärung
Am häufigsten kommt es zu einer sogenannten ausdrücklichen Willenserklärung. In diesen Fällen erklärt der Absender seinen Willen direkt und wahrnehmbar. Dabei ist es unerheblich, ob der Wille sprachlich ausformuliert erklärt oder durch ein Nicken sichtbar wird. In diesen Fällen ist es eindeutig, dass eine Willenserklärung abgegeben wurde. Auch ob diese Erklärung schriftlich oder mündlich abgegeben wurde, spielt keine Rolle.
Konkludente Willenserklärung
Die konkludente Willenserklärung kommt dadurch zu Stande, dass eine Person nicht durch aktives Tun seinen Willen erklärt. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach: der Geschäftswille einer Person wird nicht ausdrücklich erklärt, lässt sich aber am Verhalten festmachen. Wenn ein Geschäftsmann beispielsweise seine Waren im Schaufenster positioniert, ist davon auszugehen, dass er diese auch verkaufen möchte (obwohl es sich streng genommen um eine “invitatio ad offerendum” handelt). Problematisch wird es immer dann, wenn der Wille nicht eindeutig erkennbar ist. Eine konkludente Willenserklärung kommt nur dann in Frage, wenn am Geschäftsbindungswillen kein Zweifel besteht.
Schweigen per se stellt nie eine Willenserklärung dar. Ein passives Verhalten hat keinerlei Erklärungswert und wird in der Rechtspraxis nicht als Willenserklärung aufgefasst. Lediglich dann, wenn es im Voraus vereinbart wurde, kann aus dem Nichtstun ein Wille geschlussfolgert werden. Beispielsweise dann, wenn vereinbart wurde, dass sich der Geschäftsführer innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nochmal meldet, sollte das Geschäft doch nicht abgeschlossen werden sollen.
Abgrenzung: empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige Willenserklärung
Ein weiterer entscheidender Abgrenzungsfaktor ist, ob es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung handelt oder nicht. Empfangsbedürftig ist eine Willenserklärung dann, wenn sie an eine bestimmte Person gerichtet ist, die die Erklärung wahrnehmen muss, damit ein Rechtsgeschäft geschlossen wird. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Angebot und Annahme im Zuge eines Kaufvertrages erklärt werden sollen. Nicht empfangsbedürftig sind Willenserklärungen, die nicht von einer anderen Person unmittelbar empfangen werden müssen. Das populärste Beispiel ist das Erklären des letzten Willens in Form eines eigenhändigen Testaments. Hier wird zwar eine Willenserklärung abgegeben, diese muss aber nicht empfangen werden, um Wirksamkeit zu entfalten. Das Rechtsgeschäft (die Auszahlung des Erbes) erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Weg der Willenserklärung:
Damit ein Vertrag abgeschlossen werden kann, müssen in der Regel zwei Willenserklärungen vorliegen. Damit es zu einem wirksamen Vertragsschluss kommt, müssen diese Willenserklärungen jedoch nicht nur abgegeben, sondern auch zugegangen sein. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welchen Weg eine Willenserklärung nehmen muss, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen und warum diese eng mit der Vertragsfreiheit verbunden ist.
1. Abgabe durch den Erklärenden
Bei einer einseitigen Willenserklärung ist die Erklärung bereits ausreichend, damit die Willenserklärung wirksam wird. Handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung so muss die Erklärung in Richtung des Empfängers “versendet” werden. Eine Willenserklärung wird nämlich regelmässig erst dann wirksam, wenn der Empfänger sie empfangen hat. Man unterscheidet zwischen drei Fallgruppen:
- Mündliche Willenserklärung: muss derart geäussert werden, dass der Empfänger sie verstehen kann.
- Schriftliche Willenserklärung bei Anwesenheit des Empfängers: durch Übergabe der Erklärung gegeben.
- Schriftliche Willenserklärung bei Abwesenheit des Empfängers: durch das “auf den Weg bringen” der Erklärung – beispielsweise Abgabe bei der Post.
2. Zugang bei dem Empfänger
Der Zugang wird in der Schweiz durch die Empfangstheorie bestimmt. Nach dieser gilt eine Willenserklärung dann als zugegangen, wenn unter normalen Umständen damit gerechnet werden kann, dass der Empfänger Kenntnis von der Erklärung erlangt hat. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob der Empfänger tatsächlich von der Erklärung weiss. Wenn der Empfänger beispielsweise seinen Briefkasten über Wochen nicht leert, hindert das nicht den Zugang einer Willenserklärung. Entscheidend ist, dass die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist.
Diese Bestimmung ist wichtig, da sich hier entscheiden kann, ob eine Willenserklärung rechtzeitig zugegangen ist oder nicht. Beispielsweise regelt Art. 9 OR, dass ein Angebot oder eine Annahme widerrufen werden kann, wenn der Widerruf gleichzeitig oder vor der eigentlichen Willenserklärung eintrifft. Anderes Beispiel: wollen Sie einen Mietvertrag kündigen, entscheidet das Datum des Zugang darüber, ab wann die Kündigungsfrist beginnt zu verstreichen. Damit lässt sich der Zugang einer Willenserklärung nicht dadurch verhindern, dass der Empfänger seinen Briefkasten abmontiert oder verklebt. Unter normalen Umständen wäre die Willenserklärung zugegangen und der Zugang wird so fingiert, als hätte das Hindernis nicht vorgelegen.

Auslegung von Willenserklärungen
Eine Willenserklärung setzt sich aus dem Willen einer Person und der Erklärung diesen Willens zusammen. Es kann vorkommen, dass eine Erklärung mehrdeutig ist. In diesen Fällen muss die Willenserklärung rechtskonform ausgelegt werden. Diese Auslegung hat zur Aufgabe zu ermitteln, ob eine Willenserklärung tatsächlich abgegeben wurde oder nicht. Ein bekanntes Beispiel ist der Weinversteigerungsfall. Dabei kam ein Händler in eine Versteigerungshalle, hob zur Begrüssung eines Freundes die Hand und bekam daraufhin den Zuschlag für einen Wein, den er nicht haben wollte. Der Auktionator hatte das Handzeichen als Gebot aufgefasst, obwohl der Händler gar keinen Kauf herbeiführen wollte. Die Auslegung beschäftigt sich mit der Frage: wie ist mit solchen Willenserklärungen umzugehen? In der schweizer Rechtspraxis haben sich zwei Prinzipien etabliert:
Willensprinzip und Vertrauensprinzip
Nach dem Willensprinzip wird der Inhalt einer Erklärung nicht nach dem objektiv Erklärten ermittelt. Es wird viel mehr geschaut, was der Erklärende tatsächlich mit seiner Erklärung hat aussagen wollen (subjektiver Wille). Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Kunde auf eine Gitarre zeigt, aber sagt, er wolle eine Geige kaufen, obwohl das Geschäft gar keine Geigen verkauft. Der Irrtum über die Kaufsache ist unerheblich, da ein objektiver Dritter weiss, was gemeint ist.
Das Vertrauensprinzip besagt, dass eine Willenserklärung nach dem objektiv Erkennbaren bewertet werden muss. Bedeutet konkret: es gilt der Wille, der von einem objektiven Dritten erkennbar ist. Diese Methode der Auslegung schützt den Empfänger, da er auf die Richtigkeit des geäusserten Willens vertrauen darf – sofern ein gesunder, vernünftiger Mensch dies auch tun würde. Kommt es dann zu einem Vertragsschluss, der nicht vom Erklärenden gewollt war, kann er die Erklärung auf Grund eines Irrtums anfechten und das Geschäft somit abwenden. Dabei macht er sich jedoch dem Empfänger gegenüber schadenersatzpflichtig. Sie haben es sicher gemerkt: das Thema Auslegung von Willenserklärungen ist komplex und durchzogen von juristischen Spitzfindigkeiten. Schlussendlich gilt es zwei Interessen abzuwägen:
- Das Interesse des Erklärenden, dass nur seinem tatsächlichen Willen entsprochen wird, auch wenn er objektiv etwas anderes erklärt hat.
- Das Interesse des Empfängers sich darauf verlassen zu können, dass der geäusserte Wille dem tatsächlichen Willen entspricht.
Massstab der Bewertung ist stets der objektive Empfängerhorizont. Wie hätte ein unbeteiligter Dritte die Erklärung verstanden?
Klassisches Beispiel: Angebot und Annahme
Eine der häufigsten Vertragsarten ist der Kaufvertrag. Bei diesem erklärt der Käufer, dass er vom Verkäufer eine bestimmte Sache zu einem vereinbarten Preis erwerben möchte. Damit der Kaufvertrag wirksam entsteht, braucht es also zwei übereinstimmende Willenserklärungen. In diesem Kontext spricht man von Angebot und Annahme. Ein klassisches Beispiel:
Sie möchten ein Auto von Person A kaufen. Diese Person macht Ihnen ein Angebot. Das Angebot klärt die wesentlichen Vertragspunkte (Parteien, Kaufsache, Kaufpreis). Daraufhin erklären Sie, dass Sie das Angebot annehmen möchten (Annahme). Sie haben mithin jeweils eine Willenserklärung abgegeben, die darauf gerichtet war, das bestimmte Rechtsgeschäft zu vollziehen. Der Kaufvertrag ist gültig. Der Verkäufer muss seiner Leistungspflicht nachkommen und Ihnen das Fahrzeug übereignen. Umgekehrt sind Sie verpflichtet den Kaufpreis zu zahlen.
Sonderfall: Scherzerklärungen
Die sogenannte Scherzerklärung ist ein Sonderfall der Willenserklärung. Dabei erklärt eine Person seinen Willen, obwohl dieser gar nicht in der geäusserten Form vorliegt. Der Erklärende geht davon aus, dass dies dem Empfänger bekannt ist. In diesen Fällen ist zu ermitteln, ob die fehlende Ernsthaftigkeit vom Empfänger zu erkennen war oder nicht. Zwei Beispiele:
- Sie erklären Ihrem guten Freund, Sie wollen sein altes Auto für eine Millionen CHF kaufen, obwohl dieses nur 3.000 CHF wert ist. Dabei lachen Sie laut. Hier ist eindeutig zu erkennen, dass es Ihnen am Rechtsbindungswillen fehlt.
- Sie erklären KFZ-Händler, dass Sie fünf Autos eines bestimmten Modells kaufen möchten. Anschliessend informieren Sie sich eingehend über das KFZ, machen eine Probefahrt und zeigen sich weiter interessiert. Innerlich wissen Sie, dass Sie maximal ein Auto benötigen. In diesem Fall muss der Verkäufer nicht erkennen, dass Sie den Kauf von fünf Autos nicht in Betracht ziehen – das ist durchaus nicht unüblich (beispielsweise für eine Firmenflotte). Er reserviert die Autos für Sie und ihm entgeht dadurch ein Gewinn. Diesen müssen Sie ggf. im Zuge eines Anspruchs auf Schadenersatz ersetzen.
Anfechtung einer Willenserklärung:
Häufig wird davon gesprochen, dass ein bestimmter Vertrag angefochten werden soll. Die Anfechtung ist ein Rechtsinstrument, welches die Aufgabe hat, Verträge, die nicht Ihrem Willen entsprechen, ungültig werden zu lassen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass sich die Anfechtung stets auf die zugrundeliegende Willenserklärung bezieht. Grundsätzlich ist eine Willenserklärung rechtlich bindend. Dies hat den Grund, dass sich die andere Vertragspartei auf die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts verlassen können soll. In bestimmten Fällen kann jedoch eine Anfechtung erklärt werden.
Anfechtungsgründe in der Schweiz
Damit die Anfechtung wirksam erklärt werden kann, muss eine offizielle Anfechtungserklärung abgegeben werden. Dabei muss die Erklärung innerhalb eines Jahres nach Bekanntwerden des Anfechtungsgrundes offenkundig gemacht werden – das steht in Art. 31 Abs. 1 OR. Es gibt unterschiedliche Anfechtungsgründe. Damit die Anfechtung der Willenserklärung Aussicht auf Erfolg hat, muss mindestens einer der Anfechtungsgründe vorliegen:
- Absichtliche Täuschung
- Verträge die auf Grund von Drohung oder Erpressung geschlossen wurden
- Wesentlicher Irrtum bei Vertragsschluss (Willensmängel)
- Sittenwidrigkeit
Wirkung der Anfechtung auf den Vertrag
Ist die Anfechtung erfolgreich, so kann der Vertrag “ex nunc” oder “ex tunc” für ungültig erklärt werden. Ex nunc bedeutet, dass der Vertrag für die Parteien fortan nicht mehr gelten soll. Ex tunc bedeutet, dass ein Vertrag rückwirkend für die Vergangenheit an Wirksamkeit verliert. Das öffnet Tür und Tor für etwaige Rückabwicklungsansprüche. In jedem Fall wird der Vertrag aufgelöst und es sind die weiteren Rechtsfolgen zu klären. So macht sich beispielsweise derjenige, der einem Irrtum erlegen ist, schadenersatzpflichtig, sofern dieser Irrtum für den Empfänger der Willenserklärung nicht zu erkennen war. Sein Vertrauen auf die Richtigkeit der Willenserklärung ist schutzwürdig. Hätte er den Irrtum erkennen müssen, so ist in der Regel kein Schadenersatz fällig.
Wie kann ein Anwalt für Vertragsrecht helfen?
Willenserklärungen sind komplex und bilden die Grundlage aller Rechtsgeschäfte. Immer dann, wenn Sie einen Vertrag von besonderer Wichtigkeit schliessen möchten, sollten Sie einen Anwalt für Vertragsrecht einbeziehen. Dieser verhilft Ihnen zu einem reibungslosen Vertragsschluss und verhindert, dass mehrdeutige oder gar falsche Willenserklärungen abgegeben werden. Auch wenn Sie glauben, einem wesentlichen Irrtum erlegen zu sein, macht es Sinn, sich an einen Anwalt für Vertragsrecht zu wenden. Dieser kann beurteilen, ob eine Anfechtung Aussicht auf Erfolg hat oder nicht.
Allgemein können Sie sich mit allen Fragen bezüglich Willenserklärungen, Angebot, Annahme, Zugang, Willensmängel, Auslegung von Willenserklärungen und so weiter an Ihren Anwalt wenden. Es gibt zahlreiche rechtliche Besonderheiten, die beachtet werden müssen. Wenn Sie einen Anwalt für Vertragsrecht benötigen, empfehlen wir Ihnen unsere Anwalts-Suchfunktion zu nutzen. Mit dieser finden Sie schnell und einfach kompetente Anwälte für Vertragsrecht in Ihrer Nähe. Sie können kostenlos ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren.

FAQ: Willenserklärung
Eine Willenserklärung ist eine äusserlich erkennbare Erklärung über den Willen ein bestimmtes Rechtsgeschäft abschliessen zu wollen. Die Willenserklärung bildet das Fundament für alle Vertragsabschlüsse und ist zentraler Teil des Vertragsrechts in der Schweiz. Das bekannteste Beispiel für eine Willenserklärung ist das Zusammenspiel zwischen Angebot und Annahme. Ein alltägliches Beispiel: ein Händler legt seine Waren im Schaufenster aus. Er lädt Sie damit dazu ein, ihm ein Angebot zu machen. Legen Sie die Ware auf das Kassenband, so ist das Ihr Angebot, die Kaufsache zum ausgewiesenen Preis zu erwerben. Indem er Ihnen Eigentum verschafft, erfüllt er seine Leistungspflicht und gibt eine Willenserklärung ab, dass er Ihr Angebot annehmen möchte. Ein wirksamer Kaufvertrag ist geschlossen worden.
Eine Willenserklärung liegt immer dann vor, wenn eine Person ernsthaft in der Absicht, ein gewisses Rechtsgeschäft herbeizuführen, seinen Willen gegenüber einem Dritten erklärt (empfangsbedürftige Willenserklärung). Bei nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen muss die Willenserklärung nicht zugehen, um Gültigkeit zu erlangen. Die Willenserklärung muss gewissen Standards entsprechen, ausreichend bestimmt sein und sich auf den Vollzug eines Rechtsgeschäfts richten.
Die Anfechtung ist ein Rechtsinstitut, um gegen Willenserklärungen vorzugehen, die nicht Ihrem tatsächlichen Willen entsprechen. Die Anfechtung muss innerhalb eines Jahres durch eine Anfechtungserklärung erklärt werden. Sie hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn ein Anfechtungsgrund vorliegt. Ein solcher Grund kann beispielsweise ein Irrtum über wesentliche Aspekte des Vertragsschlusses sein. Welche Auswirkungen die Anfechtung für die Vertragsparteien hat, hängt vom Einzelfall ab.

Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.