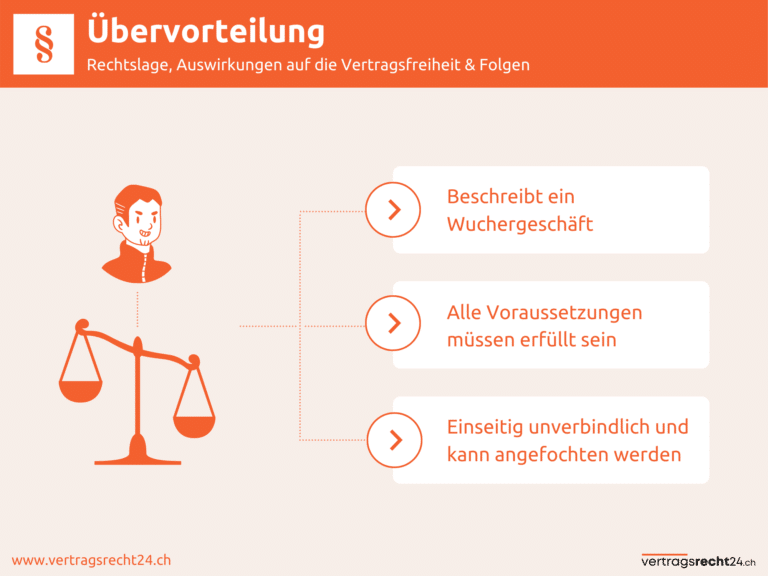Übervorteilung § Auswirkungen, Folgen & mehr
- Redaktion
- Lesezeit: ca. 12 Minuten
- Teilen
- 15 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.
Die Übervorteilung – auch häufig als Wucher bezeichnet – erlaubt es Ihnen, sich von einem Vertrag zu lösen, der offensichtlich unvorteilhaft für eine Partei ist. Jedoch reicht dies nicht aus, da ein unvorteilhafter Vertrag durch die Vertragsfreiheit gedeckt ist. Vielmehr muss die übervorteilte Partei in der Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt gewesen sein und dieser Umstand wurde genutzt, um sich einen unsittlichen Vorteil zu verschaffen. In diesem Beitrag erfahren Sie, in welchem Verhältnis Übervorteilung und Vertragsfreiheit stehen, was die Übervorteilung ist, unter welchen Voraussetzungen sie vorliegt und welche Rechtsfolgen sich daraus ergeben.
- Das Wichtigste in Kürze
- Die Übervorteilung ist in Art. 21 OR geregelt und beschreibt ein Wuchergeschäft.
- Die drei Voraussetzungen für eine Übervorteilung müssen kumulativ vorliegen - einzelne Voraussetzungen genügen nicht.
- Voraussetzungen sind: Missverhältnis, beeinträchtigte Entscheidungsfreiheit, bewusstes Ausnutzen der Beeinträchtigung.
- Ein derart geschlossener Vertrag ist einseitig unverbindlich und kann angefochten werden.
- Die Anfechtung muss innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss erfolgen und hat zur Folge, dass die Parteien so zu stellen sind, als hätte es keine Vereinbarung gegeben.
Zusammenhang zwischen Vertragsfreiheit und Übervorteilung
In der Schweiz herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit und die Vertragsparteien können – innerhalb der Schranken des Gesetzes – alles vereinbaren, was sie möchten. Sie können Verträge frei schliessen, ändern oder beenden. Jedoch findet die Vertragsfreiheit dort ihre Grenzen, wo sie mit geltendem Recht kollidiert.
Das ist beispielsweise bei Sittenwidrigkeit, Widerrechtlichkeit oder eben der Übervorteilung der Fall. In diesen Fällen können Sie sich nicht auf die Vertragsfreiheit berufen, da der Schutz des rechtskonformen Rechtsverkehrs die Privatautonomie beschränkt.
Ein Beispiel: Sie besitzen ein wertvolles Gemälde und wollen dieses Verkaufen. Der Verkauf kommt für Sie nur in Betracht, da Sie sich in einer finanziellen Notlage befinden und Ihre Familie ernähren müssen. Sie wissen nicht genau, was das Kunstwerk wert ist, gehen aber davon aus, dass rund 1.000 CHF ein angemessener Preis sind. Ein Kunstsammler entdeckt Ihr Angebot und erkennt sofort, dass das Gemälde deutlich über 40.000 CHF wert ist. Er setzt Sie unter Druck das Bild zu verkaufen, um anschliessend selbst Gewinn zu machen.
Grundsatz Vertragsfreiheit:
Würde man nach den Grundsätzen der Vertragsfreiheit gehen, so könnte ein Kaufvertrag über 1.000 CHF abgeschlossen werden. Die Inhaltsfreiheit erlaubt es Ihnen, den Preis selbst festzulegen. Der Kaufvertrag wäre wirksam und Sie müssten das Bild übereignen.
Einschränkung durch Übervorteilung:
Die Übervorteilung ist ein Grund, die Vertragsfreiheit zum Schutz einer Vertragspartei einzuschränken. Niemand soll Opfer von Wucher werden oder unter einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung leiden müssen, wenn seine Entscheidungsfreiheit eingeschränkt war. Mithin könnte die Inhaltsfreiheit – durch das Verbot eine Partei zu übervorteilen – eingeschränkt werden.
Was ist eine Übervorteilung?
Aber was ist die Übervorteilung überhaupt? Menschen, die wenig mit dem Recht bzw. Gesetz in Kontakt kommen, kennen die Übervorteilung als “Wucher”. Im Gesetz ist der Tatbestand der Übervorteilung in Art. 21 OR geregelt. Dort steht:
“Wird ein offenbares Missverhältnis zwischen der Leistung und der Gegenleistung durch einen Vertrag begründet, dessen Abschluss von dem einen Teil durch Ausbeutung der Notlage, der Unerfahrenheit oder des Leichtsinns des andern herbeigeführt worden ist, so kann der Verletzte innerhalb Jahresfrist erklären, dass er den Vertrag nicht halte, und das schon Geleistete zurückverlangen.”
Art. 21 Absatz 2 OR bestimmt, dass die Jahresfrist mit dem Vertragsschluss beginnt zu verstreichen. Wichtig ist, dass die einzelnen Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen. Besteht nur ein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, es bestand jedoch keine Einschränkung der Entscheidungsfreiheit, so spricht man nicht von Übervorteilung. Es kommt – je nach Einzelfall – eine Sittenwidrigkeit in Betracht.
Voraussetzungen der Übervorteilung
Wie Sie sehen, ist die Übervorteilung im Gesetz explizit geregelt und es gibt drei Voraussetzung vorliegen müssen, damit eine Partei übervorteilt wurde. Ob diese Voraussetzungen schlussendlich vorliegen oder nicht, ist von der übervorteilten Partei vor Gericht zu beweisen. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Gerichts. Wenn Sie Opfer einer Übervorteilung geworden sind, müssen Sie beweisen, dass alle drei Voraussetzungen vorgelegen haben. Gelingt Ihnen dies, so können Sie sich vom Vertrag lösen und sind nicht verpflichtet, zu leisten. Zu den Rechtsfolgen gleich mehr.
Offenbares Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
Grundvoraussetzung der Übervorteilung ist ein offenbares Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Um die Vertragsfreiheit nicht übermässig stark einzuschränken, wird dem Wort “offenbar” eine besondere Bedeutung beigemessen. Denn grundsätzlich darf der Preis frei bestimmt werden (Inhaltsfreiheit). Was genau ist ein offenbares Missverhältnis?
- Offenbar = ein Missverhältnis, welches einem objektiven, sachkundigen Betrachter sofort auffällt
- Missverhältnis = gegenüber dem günstigsten, am Markt existierenden Kaufpreis (Massstab)
Eine Übervorteilung kann also nur dann vorliegen, wenn eine deutliche Diskrepanz zu erkennen ist, die nicht als “Schnäppchen” aufgefasst werden kann. Ein einfaches Beispiel: Sie möchten ein Auto verkaufen, welches normalerweise 10.000 CHF kostet. Einzelne Angebote belaufen sich auf 15.000 CHF. Nun verlangen Sie jedoch 50.000 CHF von einer Person, die unbedingt auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen ist, um die schwangere Frau ins Krankenhaus zu fahren. Der Preis ist – im Vergleich zu den marktüblichen Bedingungen – exorbitant hoch und steht in keinem Verhältnis. Mithin ist in diesem Beispiel ein offenbares Missverhältnis anzunehmen. Anders sieht es aus, wenn Sie das Auto für 16.000 CHF verkaufen würden.
Übrigens werden bei der Ermittlung des marktüblichen Verkehrswertes nur gleichwertige Gegenstände herangezogen. Sie können nicht argumentieren, dass dieses Auto als Neuwagen 55.000 CHF gekostet hat, wenn das verkaufte KFZ bereits 20 Jahre alt ist und mehr als 200.000 Kilometer gefahren wurde. Ausschlaggebend ist stets die vertraglich vereinbarte Leistung. Die tatsächliche Leistung, die bereits erfolgt ist, spielt keine Rolle. Hat Ihnen die Person aus dem Beispiel oben 10.000 CHF als Anzahlung geleistet und Sie übergeben das Auto, so kann trotzdem eine Übervorteilung vorliegen. Was im Vertrag steht gilt und wird zur Bewertung herangezogen. Das macht Sinn, da diese Leistung verlangt werden kann.
Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit
Das Missverhältnis allein reicht jedoch nicht aus, um sich auf eine Übervorteilung berufen zu können. Der Übervorteilte muss in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt gewesen sein. Was unter einer Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit zu verstehen ist, wird häufig diskutiert. Art. 21 OR liefert eine Aufzählung von Fallkonstellationen, in welchen von einer Beschränkung ausgegangen werden kann. Bedenken Sie jedoch, dass diese Aufzählung nicht abschliessend ist:
- Vertragspartei befindet sich in einer Notlage
- Handelt aus Unerfahrenheit
- Ist leichtsinnig und kann die Folgen seiner Handlungen nicht absehen
Eine Notlage besteht dann, wenn bestimmte Rechtsgüter einer Person in Gefahr sind. Ein gesundheitlicher Notfall, eine hohe Verschuldung oder eine lebensbedrohliche Situationen können eine Notlage darstellen. Hier ist stets im Einzelfall zu entscheiden. Unerfahrenheit oder Leichtsinn liegen vor, wenn der Übervorteilte die Tragweite seiner Handlungen nicht abschätzen kann. Grund dafür kann sein, dass ihm der nötige Sachverstand oder die gebotene Vorsicht fehlt. Ein weiterer Grund für die Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit ist der Einfluss von Alkohol oder Drogen. Der Rausch kann zu einer eingeschränkten Handlungs- bzw. Geschäftsfähigkeit führen, was schon Anfechtungsgrund allein sein kann. Im Kontext der Übervorteilung erfüllt der Rausch jedoch ebenso das Merkmal der Willensbeeinträchtigung.
Wichtig ist auch, dass die Entscheidung zum Vertragsabschluss eben durch diese Beschränkung erfolgt ist. Es reicht nicht aus, dass Sie allgemein von einem solchen Umstand belastet wurden, aber den Vertrag auch ohne die Notlage geschlossen hätten. Der Jurist spricht von einem Kausalzusammenhang. Die Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit muss dazu geführt haben, dass der Vertrag überhaupt abgeschlossen wurde. Umgekehrt: hätte die beeinträchtigende Situation nicht vorgelegen, hätte es keinen Vertragsschluss gegeben.
Kausal ist das Handeln, was nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandsmässige Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele.

Bewusste Ausnutzung der beeinträchtigten Entscheidungsfreiheit
Schliesslich ist die letzte Voraussetzung für das Vorliegen einer Übervorteilung, dass die andere Vertragspartei die beeinträchtigte Entscheidungsfreiheit bewusst ausgenutzt hat. Grundlage dafür bildet, dass er / sie erkannt haben muss, dass es ein Ungleichgewicht zwischen beiden Parteien gegeben hat. Die übervorteilende Person muss von der beeinträchtigen Entscheidungsfreiheit gewusst haben und auch in Kenntnis des offenbaren Missverhältnisses von Leistung und Gegenleistung gewesen sein. Es ist jedoch keine Voraussetzung, dass diese Person den Vertragsschluss angeregt hat. Das kann auch der Übervorteilte getan haben.
Welche Rechtsfolgen hat das Übervorteilen?
Wenn Sie einen Vertrag abschliessen, der den Tatbestand der Übervorteilung erfüllt, stellt sich die Frage, welche Folgen das für die Vereinbarung hat. Der Jurist spricht in diesen Fällen davon, dass der Vertrag einseitig unverbindlich ist. Unverbindlich ist er für diejenige Seite, die übervorteilt wurde. Er kann innerhalb eines Jahres angefochten werden. Dafür muss die Anfechtung erklärt und begründet werden. Erfolgt die Anfechtungserklärung nicht innerhalb eines Jahres, so wird der Vertrag für beide Seiten verbindlich und ist wirksam. Hat die Anfechtung Erfolg, müssen Leistungen rückabgewickelt werden. Die Vertragsparteien sind so zu stellen, als hätte es das Vertragsverhältnis nie gegeben.
Alternativ kommt ein Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der culpa in contrahendo in Betracht. Dabei ist Voraussetzung, dass die ausnutzende Partei eine Pflicht schuldhaft verletzt hat und diese Verletzung auch vertreten muss. Im Regelfall erfolgt die Rückabwicklung bei der Übervorteilung jedoch dadurch, dass der Rechtsgrund für die Leistung entfallen ist. Für Sie wichtig ist, dass Sie sich merken, dass Sie lediglich ein Jahr Zeit haben, um gegen eine Übervorteilung vorzugehen. Eine Beratung durch einen Anwalt für Vertragsrecht ist stets sinnvoll und erleichtert die Anfechtung bzw. Aufhebung von übervorteilenden Verfügungen enorm.
Wie kann ein Anwalt für Vertragsrecht helfen?
Die Übervorteilung ist in der Rechtspraxis zwar vergleichsweise selten, kommt jedoch vor. Wenn Sie vermuten, dass Sie einen Vertrag geschlossen haben, der die Voraussetzungen der Übervorteilung erfüllt, sollten Sie sich dringend an einen Anwalt für Vertragsrecht wenden. Dieser berät Sie bezüglich Vertragsgestaltung und Vertragsabschluss. So kann oft im Voraus schon vermieden werden, dass ein Vertrag, der eine Partei ungerechtfertigterweise übervorteilt, geschlossen wird.
Sollte es bereits zu spät sein, kann ein Anwalt den Vertrag für Sie anfechten und für unwirksam erklären lassen. Dadurch werden Sie von Ihrer Leistungspflicht entbunden und es muss ein Zustand hergestellt werden, als hätte es die Übervorteilung bzw. den übervorteilenden Vertrag nie gegeben. Ihr Anwalt für Vertragsrecht prüft ausserdem, wie der eine bereits erfolgte Leistung rückabzuwickeln ist. Wenn Sie in der Schweiz einen Anwalt für Vertragsrecht benötigen, empfehlen wir Ihnen unsere Anwalts-Suchfunktion zu nutzen. Mit dieser finden Sie in wenigen Sekunden kompetente Anwälte in Ihrer Nähe. Einfach kostenlos einen Termin vereinbaren und die Möglichkeit einer unverbindlichen Erstberatung nutzen.

FAQ: Übervorteilung
Die Übervorteilung ist in Art. 21 OR geregelt und stellt einen Anfechtungsgrund dar, der die Vertragsfreiheit einschränken kann. Wenn eine Vertragspartei übervorteilt wurde, kann der Vertrag angefochten und für unwirksam erklärt werden. Damit dies möglich ist, müssen die drei Voraussetzungen der Übervorteilung vorliegen: Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit und bewusstes Ausnutzen dieser Beeinträchtigung. Diese Voraussetzungen müssen vorliegen, damit von einer Übervorteilung gesprochen werden kann. Liegen nur eine oder zwei Voraussetzungen vor, so ist Art. 21 OR nicht einschlägig und der Vertrag kann nicht auf dieser Grundlage angefochten werden. Übervorteilen könnte umgangssprachlich auch “Wucher” genannt werden. Sie liegt beispielsweise dann vor, wenn eine betrunkene, alkoholkranke Person zum Verkauf seines Fahrzeuges für 100 CHF gedrängt wird. Ein solcher Vertrag ist anfechtbar.
Ein Vertrag wird durch eine Übervorteilung nicht automatisch unwirksam. Wird eine Vereinbarung geschlossen, die eine Vertragspartei übervorteilt, dann gilt die Vereinbarung zwar, der Übervorteilte kann jedoch eine Anfechtung bemühen. Der Vertrag ist damit einseitig unverbindlich. Innerhalb eines Jahres muss der Übervorteilte die Anfechtung erklären. Unterbleibt dies und es wird innerhalb eines Jahres keine Anfechtung erklärt, verstreicht die Frist und der Vertrag ist rechtsverbindlich und wirksam. Die Vertragspartei, die übervorteilt wurde, muss also aktiv werden, um sich von dem Vertrag zu lösen. Tut er / sie dies nicht, muss geleistet werden.
Die Beweislast ist in Art. 8 ZGB geregelt. Im Fall der Übervorteilung muss die übervorteilte Person beweisen, dass die Voraussetzung vorgelegen haben, als der Vertrag geschlossen wurde. In welcher Form dieser Beweis geführt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Das Gericht kann nach freiem Ermessen entscheiden, wenn es um die Frage geht, ob der Beweis ausreicht oder nicht. Dementsprechend wichtig ist es, die drei Voraussetzungen der Übervorteilung glaubhaft zu machen. In der Regel liegt die Schwierigkeit darin zu beweisen, dass die Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt gewesen ist und dass dieser Umstand ausgenutzt wurde. Das offensichtliche Missverhältnis ist objektiv leichter zu erkennen.

Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.