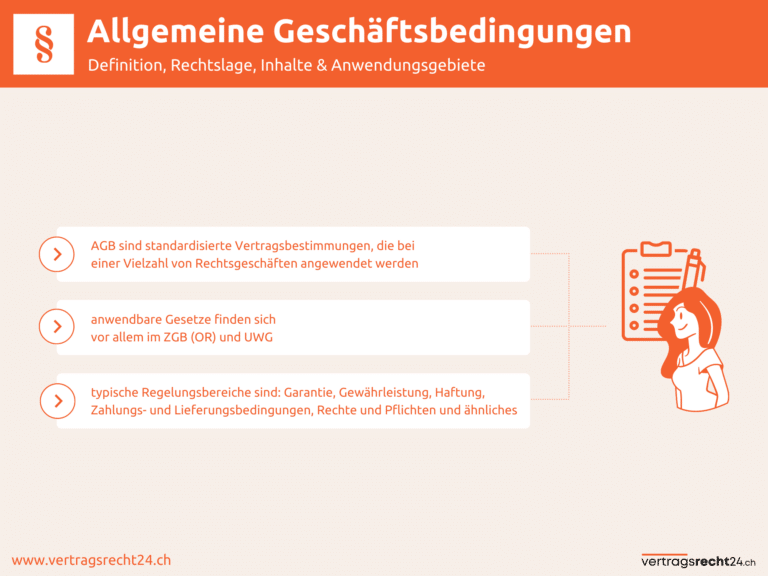Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) § Formvorschriften & Inhalte
- Redaktion
- Lesezeit: ca. 10 Minuten
- Teilen
- 4 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.
- Das Wichtigste in Kürze
- Anwendbare Gesetze finden sich vor allem im ZGB (OR) und UWG, wobei die Gestaltungsmöglichkeiten durch die Vertragsfreiheit umfangreich sind.
- Damit die Klauseln gelten, müssen sie in Schriftform einsehbar sein, zur Kenntnis genommen und akzeptiert werden.
- Typische Regelungsbereiche sind: Garantie, Gewährleistung, Haftung, Zahlungs- und Lieferungsbedingungen
Rechtslage Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auch wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen eine bedeutsame Rolle spielen, gibt es nur wenige Gesetze, die sich speziell und abschliessend mit Ihnen befassen. Die Vertragsfreiheit besagt, dass die Vertragsparteien – unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften – Verträge frei nach ihrem Willen begründen, ändern und auflösen können. Relevante Gesetze finden sich vor allem im Obligationenrecht (OR). Dort werden die einschlägigen Schuldverhältnisse rechtlich konkretisiert. Grundlagen für Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie in:
- Art. 1 OR: Der Vertrag wird durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen geschlossen
- Art. 6 OR: Abschluss eines Vertrages ohne ausdrückliche Annahme (stillschweigende Annahme)
- Art. 18 OR: Grundlagen der Vertragsauslegung, wobei der tatsächliche Wille der Parteien – und nicht die Bezeichnung – massgebend ist.
- Art. 8 UWG: AGB sind unlauter, wenn ein erhebliches Missverhältnis zwischen Rechten und Pflichten der Parteien entsteht.
- KIG (Konsumenteninformationsgesetz): Bestimmungen zur Förderung der objektiven Information von Konsumenten
- Art. 8 ZGB: Sofern nicht anderweitig bestimmt, obliegt die Beweislast dem, der Ansprüche geltend machen möchte.
Definition Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen (kurz: AGB) sind im fester Bestandteil im Rechtsverkehr und nicht mehr wegzudenken. Grundsätzlich spricht man von AGB, wenn vorformulierte Vertragsklauseln genutzt werden, um ein Geschäft abzuschliessen. In der Regel verfügen Unternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen – Online-Shops, Versicherungen, Banken, Reisebüros etc. – über solche Bestimmungen, um: Eine Vielzahl einheitlicher Verträge mit Kunden abzuschliessen Rechtsfragen, die unter Umständen zu Problemen führen könnten, standardisiert zu klären (z.B. Rechtsstand, Haftungsfragen usw.)
Welche Klauseln bzw. Informationen in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen werden, kann in den Grenzen des geltenden Rechts frei bestimmt werden. Es gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Das bedeutet auch, dass die in den AGB getroffenen Regelungen Vorrang vor gesetzlichen Bestimmungen haben. Somit ist es möglich, dass Rechte von Verbrauchern durch Allgemeine Geschäftsbedingungen eingeschränkt werden. Problematisch ist dabei, dass man zwar gesetzlich nicht zur Annahme der Klauseln verpflichtet ist, das Unternehmen jedoch ebenfalls davon absehen kann, mit Ihnen Geschäfte zu machen, wenn Sie die Bestimmungen nicht akzeptieren.
Stillschweigende Annahme der AGB
Die stillschweigende Annahme ist in Artikel 6 des Obligationenrechts geregelt. Sie besagt, dass eine ausdrückliche Annahme nicht zu erwarten ist und der Vertrag deshalb als abgeschlossen gilt, wenn er nicht innerhalb einer bestimmten Frist abgelehnt wird. Befinden sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen in einem separaten Dokument oder auf der Rückseite des Formulars, ist eine stillschweigende Annahme nicht zu vermuten. Vor allem im Onlinehandel ist es wichtig, dass der Händler die Annahme der AGB seitens des Kundens dokumentieren kann. Der Händler sollte nachweisen können, dass der Kunde Zugriff auf die AGB hatte.
Relevanz von Geschäftsbedingungen im Alltag
Allgemeine Geschäftsbedingungen sind allgegenwärtig und werden Bestandteil der meisten Geschäfte, die im Alltag geschlossen werden. Egal ob bei einem Besuch im Kino, beim Onlineshopping, Möbelkauf oder Fahrkartenkauf – immer erklären Sie sich ausdrücklich oder stillschweigend bereit, diese Regelungen zu akzeptieren. Auch bei Dienstleistungen, Service Tätigkeiten und dem Vertrieb von digitalen Produkten (bspw. Software) sind Allgemeine Geschäftsbedingungen weit verbreitet. Ob ein Schuldverhältnis zwischen zwei Unternehmen (B2B) oder einem Unternehmen und einem Konsumenten (B2C) geschlossen werden, ist grundsätzlich unerheblich, wobei es einzelne Unterschiede bei Detailfragen gibt.
Es gibt unterschiedliche Formen solcher Geschäftsbedingungen – zum Beispiel Lieferbedingungen und AKB. Wie diese Dokumente auch benannt werden, sie meinen schlussendlich das Gleiche: vorformulierte Vertragsbedingungen. Besonders dann, wenn Unternehmen unzählige Geschäfte abwickeln müssen, sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unentbehrlich. Durch diese muss nicht für jeden Kunden ein individueller Vertrag ausgearbeitet werden.
Voraussetzungen in Verbindung mit Verträgen
Damit Allgemeine Geschäftsbedingungen Bestandteil des Vertrags werden, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein: AGB Kundbarmachung, AGB Kenntnisnahme und AGB Übernahme. Wird eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, so gelten die Bestimmungen für das betroffene Schuldverhältnis nicht. Die gesetzlichen Regelungen sind dann einschlägige Rechtsquellen. Ob diese Anforderungen erfüllt wurden oder nicht, wird in drei Schritten geprüft: Allgemeine Geschäftsbedingungen müssen:
- vom Verwendeten veröffentlicht werden. So ist es beispielsweise ausreichend, wenn diese bei einem Angebot per Mail im Anhang mitgesendet werden, auf der Website einsehbar sind oder auf der Rückseite eines Schreibens abgedruckt sind. Es gilt, dass sie mit angemessenen Mitteln jederzeit einsehbar sind.
- vor Vertragsschluss von der Gegenpartei zur Kenntnis genommen werden. Dieses Kriterium gilt zum Beispiel dann als erfüllt, wenn Sie beim Onlineshopping im Checkout einen Haken setzen, der bestätigt, dass Sie die AGB gelesen haben und sie akzeptieren. In Supermärkten hängen diese meist gut sichtbar an der Kasse aus.
- von der anderen Partei angenommen bzw. übernommen werden. Geschieht dies nicht, gelten die Regelungen nicht. Es gibt keine Verpflichtung, die Sie zwingt, bestimmte Bestimmungen anzunehmen. Sollten Sie sich weigern, wird das Geschäft höchstwahrscheinlich nicht geschlossen werden. In vielen Fällen – ausgenommen Internet-Geschäfte – erfolgt die Annahme konkludent. Das bedeutet, dass Sie durch Ihre Handlungen (indirekt) Ihre Zustimmung erteilen.
Sofern diese drei Prüfungspunkte zu bejahen sind, ist davon auszugehen, dass AGB Vertragsbestandteil geworden sind und Wirksamkeit entfalten. Beide Parteien sind demnach verpflichtet, die vereinbarten Rechten und Pflichten zu achten.
Formvorschriften für Geschäftsbedingungen
Es gibt kein Gesetz, welches genau bestimmt, in welcher Form AGB vorliegen müssen. Mit der Zeit hat es sich durchgesetzt, dass die Klauseln der Schriftform entsprechen müssen. Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck: da es sich um vorformulierte Vertragsbedingungen handelt, die für eine Vielzahl an Verträgen eingesetzt werden soll, ist Schriftlichkeit Grundvoraussetzung. Andernfalls gäbe es bei Streitigkeiten erhebliche Beweisschwierigkeiten. In der Praxis ist es also ausgesprochen selten, dass die Einhaltung der Formvorschriften angezweifelt wird. Sofern es zu einer mündlichen Erklärung der Geschäftsbedingungen kommt, ist grundsätzlich zweifelhaft, ob es sich tatsächlich um Regelungen in Form von AGB handelt. Dagegen spricht, dass die mündliche Aufklärung nicht für eine Vielzahl unterschiedlicher Verträge eingesetzt werden kann.

AGB bei Privat- und Geschäftskunden
Wenn es um Allgemeine Geschäftsbedingungen oder ähnliche Dokumente geht, lohnt es sich zu unterscheiden, ob sie zur Konkretisierung eines Geschäfts zwischen zwei Unternehmen oder einem Unternehmen und einer Privatperson eingesetzt werden. In der Praxis sind beide Fallgruppen typisch. In seltensten Fällen verfügen Privatpersonen über eigene Geschäftsbestimmungen. Bei Geschäften zwischen Unternehmen kommt es jedoch häufiger vor, dass beide Parteien jeweils ihre eigenen AGB durchsetzen möchten. Der rechtliche Rahmen, der für AGB anwendbar ist, unterscheidet sich zwischen B2B und B2C Beziehungen teilweise. Deshalb haben viele Unternehmen eine Regelung für Unternehmensgeschäfte und eine Regelung für Privatkundengeschäfte. Die Voraussetzungen für die Wirksamkeit sind jedoch in beiden Fällen identisch. Wesentliche Unterschiede sind:
Allgemeine Geschäftsbedingungen im B2C Bereich:
- Der Verbraucher bzw. Endkunde ist in dieser Konstellation in einer unterlegenen Position. Als Verbraucher beispielsweise mit Amazon über deren Geschäftsbedingungen zu verhandeln, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Dieser “Nachteil” wird durch die Rechtsprechung versucht auszugleichen, indem Allgemeine Geschäftsbedingungen kundenfreundlich ausgelegt und angewendet werden. Der einfachen Privatperson kommt ein gewisses Schutzbedürfnis zu.
Allgemeine Geschäftsbedingungen im B2B Bereich:
- Bei Unternehmensgeschäften sind die beiden Parteien in der Regel auf Augenhöhe und verfügen über einen ähnlichen informatorischen Wissensstand. Selbst wenn bei diesen Geschäften eine Partei offensichtlich unterlegen ist, wird durch die Gerichte ein weniger umfangreicher Auslegungsmassstab angesetzt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen Inhalte
Wenn es um die Inhalte Allgemeiner Geschäftsbedingungen geht, könnte man eine scheinbar nicht enden wollende Liste anlegen. Das liegt daran, dass gemäss dem Grundsatz der Vertragsfreiheit fast alle Rechtsfragen geklärt werden können. Es kommt also entscheidend darauf an, für welche Art von Geschäft die vorliegenden Geschäftsbedingungen eingesetzt werden sollen. Besonders Unternehmen sollten die Wichtigkeit individuell angepasster Bestimmungen nicht unterschätzen. Werden dort ungewollte Regelungen getroffen, hat dies Auswirkungen auf alle Verträge, bei welchen Allgemeine Geschäftsbedingungen Bestandteil des Vertrages geworden sind. Typische AGB Inhalte (keine abschliessende Aufzählung) sind:
- Bestimmungen bezüglich der Haftung
- Regelung der Garantie
- Leistungsort und Leistungszeitraum (ggf. Fristen)
- Zuordnung zu einem Gerichtsstand
- Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Bestimmung des anwendbaren Rechts
- Widerrufs- und Rücknahmebedingungen
- Allgemeine Darstellung der Rechte und Pflichten der Vertragspartner
- Salvatorische Klausel
Die salvatorische Klausel soll verhindern, dass die gesamten Bestimmungen unwirksam werden, sobald nur eine nicht rechtmässige Regelung getroffen wird. Da überraschende bzw. ungewöhnliche Klauseln verboten sind, stellt sich die Frage, was genau damit gemeint ist? Überraschend ist eine Klausel dann, wenn ein durchschnittlicher Kunde berechtigterweise davon ausgehen konnte, dass eine solche Bestimmung nicht getroffen wurde. Zusätzlich gilt, dass nicht gegen “Treu und Glauben” verstossen werden darf. Wer ein Recht offensichtlich missbraucht, wird vom Rechtsschutz ausgeschlossen.
Unwirksame Bestimmungen
Auch wenn die Vertragsfreiheit umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten garantiert, gibt es rechtliche Grenzen. Der Verfasser der Allgemeinen Geschäftsbedingungen darf nicht völlig willkürlich Bestimmungen treffen, die nicht mit den Rechtsgrundsätzen vereinbar sind. Werden solche rechtswidrigen Regelungen in die Geschäftsbedingungen aufgenommen, so kann das zur Folge haben, dass diese ganz oder teilweise nicht angewendet werden. Eine solche Unwirksamkeit kommt beispielsweise dann in Frage, wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen:
- Eindeutig gegen das geltende Recht verstossen.
- Neben den AGB weitere Absprachen Vertragsinhalt werden, die den Bestimmungen widersprechen.
- Völlig unerwartete Klauseln enthalten, mit welchen man nicht rechnen musste.
- Nicht einsehbar waren, sodass man keine Kenntnis über deren Inhalte erlangen konnte.
- Sachverhalte regeln, die durch ein Gesetz bestimmt und nicht in Form von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu regeln sind.
Welche Folgen sich aus solchen Verstössen ergeben, hängt massgeblich vom Einzelfall ab und kann nicht pauschal eingeschätzt werden. Es muss stets zwischen geltendem Recht, Vertragsfreiheit und Verbraucherschutz (Sicherheit des Rechtsverkehrs) abgewogen werden. Im Extremfall können unwirksame Bestimmungen dazu führen, dass die gesamten Klauseln – selbst rechtmässige Vorschriften – nicht angewendet werden können. Es gibt übrigens unterschiedliche Verfahren, nach welchen Allgemeine Geschäftsbedingungen kontrolliert werden können. Die bekanntesten sind: Geltungskontrolle, Auslegungskontrolle und Inhaltskontrolle. Das bedeutet, dass das letzte Wort stets durch Gerichte gesprochen wird.
Sind Änderungen der AGB möglich?
In der Geschäftswelt kommt es vor, dass sich die Umstände verändern, sodass auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst werden müssen. Hier gilt es grundsätzlich zu unterscheiden, ob eine Änderung von bereits in Verträgen eingebrachten Geschäftsbedingungen geht oder ob Allgemeine Geschäftsbedingungen für zukünftige Vertragsverhältnisse angepasst werden sollen. Letzteres hat nämlich keine Auswirkungen auf die bestehenden Schuldverhältnisse. Bei diesen gelten die bei Vertragsabschluss wirksamen Bedingungen.
Eine rückwirkende Änderung der AGB ist prinzipiell nicht vorgesehen und nur in absoluten Ausnahmefällen überhaupt einseitig möglich. Das liegt daran, dass die Parteien auf die Bestimmungen vertrauen dürfen, die bei Vertragsschluss vorgelegen haben. Rückwirkungen sind allgemein im rechtlichen Kontext mit Vorsicht zu geniessen. Verbraucher müssen folglich nicht akzeptieren, wenn sich wesentliche Inhalte willkürlich verändern. Teilweise könnten solche nachträglichen Änderungen einen Rücktritt vom Vertrag rechtfertigen.
Wenn es um Änderungen bei Dauerschuldverhältnissen geht, wird zumeist ein so genannter Änderungsvorbehalt eingesetzt. Sollten sich die Geschäftsbedingungen verändern, müssen die neuen Bestimmungen ausdrücklich von der anderen Partei akzeptiert werden.
Vorteile und Nachteile von AGBs
Der Einsatz von Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist in den meisten Fällen vorteilhaft. Wäre dem nicht so, würden weniger Unternehmen auf diese Form der Vertragsbestimmung zurückgreifen. Was jedoch häufig verkannt wird, ist, dass sich auch Nachteile – für Unternehmen und Verbraucher – ergeben können. Diese Nachteile können jedoch relativiert werden, indem einmalig in juristische Expertise investiert wird. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist nur schwer abschätzbar, da es auf Anzahl, Wertigkeit und Komplexität der zu regelnden Verträge ankommt.
AGB Vorteile:
- Standardisierung von gleichartigen Geschäften möglich
- Einsetzbar für eine unbestimmte Vielzahl an Verträgen (weniger Verhandlungen)
- Auf den eigenen Vorteil gerichtete Klärung von Rechtsfragen (zum Beispiel bei Haftungsbeschränkungen)
- Rechtliche Klarheit für Unternehmen, Kunden und Mitarbeiter
- Klärung von Streitfragen im Vorfeld und leichtere Beweisführung
AGB Nachteile:
- Verbraucher lesen die Geschäftsbestimmungen (häufig) nicht oder teilweise
- Fehlerhafte Regelungen haben weitreichende Folgen
- Rechtswidrige Klauseln können Gesamtheit ganz oder teilweise unwirksam werden lassen
Wie kann ein Anwalt bezüglich Allgemeinen Geschäftsbedingungen helfen?
Die Wichtigkeit von rechtssicheren und individuell gestalteten AGB wird häufig unterschätzt. Das “Kleingedruckte” ist in Streitfällen häufig ausschlaggebend. Deshalb ist es – besonders für Unternehmen – unerlässlich, beim Agb erstellen lassen, bei der Formulierung und Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf rechtliche Expertise zu vertrauen. Die Rechtslage und Rechtsprechung ist komplex und umfangreich. Man sollte daher die AGB prüfen lassen. Fehlerhafte oder unvollständige Allgemeine Geschäftsbedingungen können gravierende Schäden bzw. Ansprüche verursachen. Damit Ihnen so etwas nicht passiert, ist eine Beratung durch einen Anwalt für Vertragsrecht entscheidend. Ihr Anwalt ermittelt die klärungsbedürftigen Bereiche, zeigt die im rechtskonformen Rahmen erlaubten Gestaltungsmöglichkeiten auf und unterstützt Sie bei der einwandfreien Erstellung individueller AGB.
Auf der anderen Seite ist Käufern – bei vertraglichen Streitigkeiten durch AGB – zu raten, sich ebenfalls an einen Anwalt zu wenden. Dieser prüft die vorliegenden Vorschriften, legt die Bedingungen aus und ermittelt, ob und in welchem Umfang Ansprüche gegen das Unternehmen durchsetzbar sind. Der Umfang und die schwer zu erfassende “Juristen-Sprache” macht es für den Normalmenschen sehr schwer, die tatsächliche Rechtslage einzuschätzen.

FAQ: Allgemeine Geschäftsbedingungen
In der Schweiz gibt es keine gesetzliche Pflicht für Unternehmen und Privatpersonen, Allgemeine Geschäftsbedingungen einzusetzen. Ob AGB eingesetzt werden oder nicht, obliegt folglich den handelnden Personen. Durch die Zeitersparnis im Alltag und die Möglichkeit von den teilweise strengeren gesetzlichen Normen abzuweichen, sind AGB ein sehr häufig genutztes Instrument. Übrigens besteht für die Gegenpartei keine Pflicht zur Annahme. Wird diese verweigert, muss sich geeinigt werden oder auf der Vertragsschluss findet nicht statt.

Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.