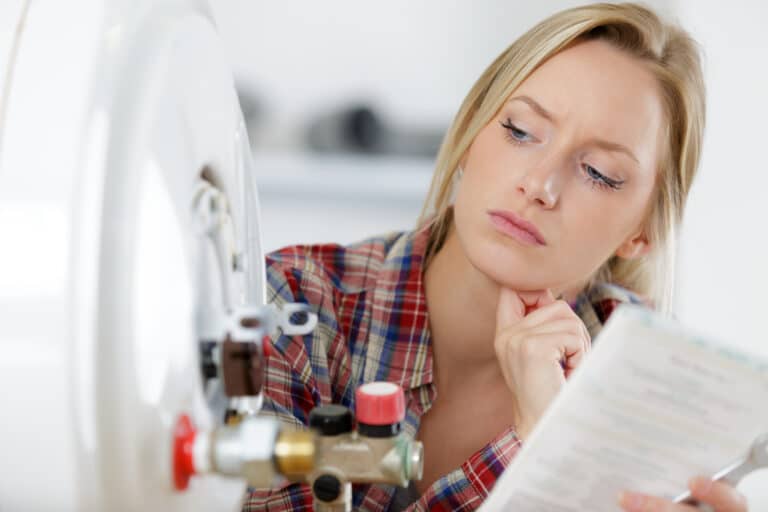Garantie § Rechtslage, Ansprüche & rechtliche Möglichkeiten
- Redaktion
- Lesezeit: ca. 12 Minuten
- Teilen
- 35 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Verkäufer hat während der Garantielaufzeit Gewähr dafür zu leisten, dass die Ware über die dem Käufer zugesicherten Eigenschaften verfügt und keine Mängel aufweist.
- Sollte der Käufer Mängel entdecken, hat er diese sofort zur Anzeige zu bringen. Andernfalls gilt die Ware mitsamt ihrer Mängel als angenommen und der Anspruch auf Garantie als verfallen.
- Eine vertragliche Anpassung der Gewährleistungspflicht ist möglich. Die Gewährleistung kann sogar gänzlich ausgeschlossen werden.
Rechtslage der Garantie
Das Gesetz verpflichtet den Verkäufer zur Gewährleistung, in der Alltagssprache auch Garantie genannt. Das heisst nach Artikel 197 des Obligationenrechts (OR), dass der Verkäufer sowohl für die zugesicherten Eigenschaften als auch für Mängel haftet, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware beeinträchtigen. Der Käufer hat die Mängel jedoch gemäss Artikel 201 des Obligationenrechts (OR) sofort nach deren Entdeckung zur Anzeige zu bringen – andernfalls gilt die Ware samt ihren Mängeln als akzeptiert. Dies ist auch dann der Fall, wenn es sich um Mängel handelt, die der Käufer schon nach Entgegennahme der Ware hätte bemerken können – dieser es jedoch unterliess, diese zu überprüfen und zu beanstanden.
Eine Beschränkung der Gewährleistung wegen versäumter Anzeige findet laut Artikel 203 des Obligationenrechts (OR) nicht statt, wenn der Käufer durch den Verkäufer absichtlich getäuscht wurde. Durch die Gewährleistung hat der Käufer laut Artikel 205 des Obligationenrechts (OR) die Möglichkeit, den Kauf mittels Wandelungsklage rückgängig zu machen oder mit der Minderungsklage Ersatz des Minderwertes der Sache zu fordern. Sollten es die Umstände nahelegen, kann das Gericht jedoch auch im Falle einer Wandelungsklage beschliessen, dem Käufer bloss Ersatz des Minderwertes zuzusprechen. Wenn der geforderte Minderwert den Betrag des Kaufpreises erreicht, kann der Käufer demgegenüber lediglich die Wandelung fordern.
Für den Fall, dass der Kauf rückgängig gemacht wird, weist Artikel 208 des Obligationenrechts (OR) darauf hin, dass der Käufer die Ware nebst dem inzwischen bezogenen Nutzen dem Verkäufer zurückzugeben hat und dass der Verkäufer diesem den Kaufpreis samt Zinsen und sonstigen Aufwendungen und Schäden, die durch die Lieferung fehlerhafter Ware entstanden sind, zurückzuerstatten hat. Möchten Sie Klage auf Gewährleistung einreichen, müssen Sie dies laut Artikel 210 des Obligationenrechts (OR) in der Regel innert 2 Jahren nach Erhalt der Ware tun, damit Ihre Ansprüche nicht verjähren. Der Verkäufer kann Umfang und Dauer der Gewährleistung aber auch vertraglich anpassen.
Abgrenzung zu Gewährleistung, Produkthaftung und Herstellergarantie
Der Begriff „Gewährleistung“ wird in der Alltagssprache eher selten angetroffen, geläufiger ist der Begriff „Garantie“. Auch wenn diese beiden Begriffe oft synonym verwendet werden, handelt es sich dabei streng genommen nicht um dasselbe. In den Gesetzestexten kommt der Begriff Gewährleistung zur Anwendung. Durch die gesetzliche Gewährleistung ist vorgesehen, dass der Verkäufer innert eines bestimmten Zeitraums nach Verkauf der Ware für Mängel haftet. Der Käufer kann die Ware dann wahlweise gegen eine intakte umtauschen, den Kauf rückgängig machen oder den entsprechenden Teil des Kaufpreises zurückfordern.
Dem Verkäufer steht es auch offen, die gesetzliche Gewährleistung auszuschliessen – allerdings muss er den Käufer vor dem Kauf ausdrücklich darauf hinweisen. Häufig tritt jedoch an die Stelle der Gewährleistung eine vertragliche Garantie – was für den Käufer durchaus mit Nachteilen verbunden sein kann. Bei der Garantie handelt es sich also um eine Anpassung der gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung durch den Kaufvertrag oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). In der Regel hat der Käufer im Rahmen einer Garantie lediglich Anspruch auf Beseitigung der Mängel durch Reparatur. Neben der Einschränkung der Wahlrechte bezüglich des Umgangs mit der mangelhaften Ware (Umtausch, Kaufpreisanpassung oder Geldrückerstattung und Rückgabe der Ware) kann auch die Dauer der Garantie bis zu einem gewissen Ausmass beliebig festgelegt werden.
Ähnlich verhält es sich mit der Herstellergarantie, die ebenfalls von der obengenannten Gewährleistungspflicht und der vertraglichen Garantie zu unterscheiden ist. Die Herstellergarantie stellt einen zusätzlichen Anspruch auf Garantie für den Käufer dar, der jedoch – wie der Name schon sagt – nicht gegenüber dem Verkäufer der Ware, sondern gegenüber dem Hersteller geltend gemacht werden kann. Umfang und Dauer der Herstellergarantie sind nicht gesetzlich vorgegeben und können vom Hersteller selbst festgelegt werden.
Wenn der Verkäufer die Gewährleistung bzw. Garantie ausgeschlossen hat oder diese bereits abgelaufen ist, sollten Sie überprüfen, ob Sie stattdessen auf eine gültige Herstellergarantie zurückgreifen können.
Von der Garantie abzugrenzen ist auch die sogenannte Produkthaftung, aus welcher Ansprüche für den Käufer entstehen können, die jedoch ebenfalls nicht unter die Gewährleistungspflicht des Verkäufers fallen. Im Rahmen der Produkthaftung haftet der Hersteller für Schäden an Personen und Sachen, die durch ein fehlerhaftes Produkt entstanden sind.
Für welche Mängel haftet der Verkäufer?
Die Gewährleistungspflicht umfasst sowohl die Sachmängelhaftung als auch die Rechtsmängelhaftung. Das heisst: Der Verkäufer haftet für etwaige Mängel wie etwa Produktionsfehler oder auch das Fehlen von wesentlichen, dem Käufer zugesicherten Eigenschaften (Sachmängelhaftung). Dabei ist es unerheblich, ob die Mängel bereits beim Kauf ersichtlich waren oder ob diese erst im Laufe der Zeit zutage getreten sind. Für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Käufers aufgetreten sind, bestehen keine Gewährleistungsansprüche. Des Weiteren hat der Verkäufer dafür Gewähr zu leisten, dass keine Rechtsansprüche Dritter – wie zum Beispiel ein Pfandrecht an der zu erwerbenden Immobilie – bestehen, die dem Käufer bei Unterzeichnung des Kaufvertrages nicht bekannt waren (Rechtsmängelhaftung).
Sollten Sie bemerken, dass die Ware mangelhaft ist bzw. dass diese nicht die Ihnen vom Verkäufer zugesicherten Eigenschaften aufweist, dann sollten Sie dies sofort zur Anzeige bringen. Andernfalls riskieren Sie, dass Sie Ihre Ansprüche verlieren, da die Ware samt ihren Mängeln als angenommen gilt, wenn sie nicht umgehend beanstandet wird. Aus selbigem Grund sollten Sie die Ware vor bzw. nach dem Kauf prüfen und es dem Verkäufer unverzüglich mitteilen, wenn Sie Mängel entdecken. Obiges gilt selbstverständlich nicht, wenn es sich um Mängel handelt, die erst im Laufe der Zeit ersichtlich wurden oder der Verkäufer Sie absichtlich über den Zustand der Ware getäuscht hat.
Laufzeiten der Garantie
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Erhalt der Ware. Im Falle einer vertraglichen Garantie kann diese Frist durch den Verkäufer jedoch auch kürzer oder länger angesetzt werden. Die gesetzliche Gewäh rleistung von mindestens 2 Jahren gilt nicht für Käufe von Händler zu Händler. Ausserdem gilt für Occassionsverkäufe (z.B. gebrauchte Waren) eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens 1 Jahr. Haben Sie ein gekauftes Produkt einmal beanstandet und es wurde durch ein neues ersetzt oder repariert, beginnt die Gewährleistung bzw. Garantie erneut zu laufen. Sie haben also dann wieder 2 Jahre Garantie für den neuen oder reparierten Gegenstand.
Oft bieten Verkäufer ihren Kunden eine Garantieverlängerung an, die jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Für Kunden empfiehlt es sich, die Sinnhaftigkeit einer solchen Garantieverlängerung vor dem Kauf genau zu überprüfen. Die gesetzliche Gewährleistung oder die Herstellergarantie machen eine Garantieverlängerung nämlich oft überflüssig.
Ansprüche aus der Garantie für den Käufer
Im Rahmen der Sachmängelhaftung entstehen für den Käufer verschiedene Ansprüche, die gesetzlich festgelegt sind. Der Käufer kann im Allgemeinen selbst wählen, welchen dieser Ansprüche er geltend machen möchte – durch Entscheidung des Gerichts oder Anpassung der Gewährleistungsansprüche im Rahmen einer vertraglichen Garantie kann der Käufer jedoch in seinen Wahlmöglichkeiten eingeschränkt werden.
Das Gesetz sieht 3 verschiedene Möglichkeiten vor, wie der Käufer seine Gewährleistungsansprüche geltend machen kann:
- Ersatz durch ein neues Produkt, sofern es sich um eine austauschbare Ware (Gattungskauf) handelt
- Wandlung: Rückgabe des Produkts und Rückerstattung des Kaufpreises
- Minderung: Rückerstattung eines Teils des Kaufpreises entsprechend dem Minderwert
Sollte es geboten erscheinen, kann das Gericht im Falle einer Wandelungsklage beschliessen, dem Käufer stattdessen Ersatz des Minderwertes zuzusprechen. Erreicht der geforderte Minderwert den Betrag des Kaufpreises, kann der Käufer ausserdem lediglich die Wandlung fordern. Im Zuge der Wandelungsklage kann der Käufer auch Schadensersatz einfordern. Eine Reparatur ist durch die gesetzlichen Gewährleistungs Vorgaben nicht vorgesehen.
Wurde im Kaufvertrag bzw. in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) eine Garantie angesetzt, ist dies ist jedoch ebenfalls eine Option. Der Käufer hat im Rahmen der Garantie oftmals nur einen Anspruch darauf, die Sache reparieren zu lassen oder diese gegen eine neue auszutauschen, wenn sich die Reparatur nicht lohnen sollte. Hinsichtlich einer Rechtsmängelhaftung ist eine Aufhebung des Kaufvertrags und/oder Forderung von Schadenersatz möglich.

Folgen bei Nichterfüllung der Garantie
Möchte man als Käufer seine Gewährleistungsansprüche bzw. seine Ansprüche aus einer vertraglichen Garantie geltend machen, kann es vorkommen, dass der Verkäufer sich weigert, diese zu erfüllen. Der Verkäufer kann zum Beispiel behaupten, dass die Mängel durch den Käufer selbst verursacht wurden – trifft dies tatsächlich zu, ist der Verkäufer aus der Gewährleistungspflicht ausgenommen. In solchen Situationen kann es für den Käufer mit einigen Hürden verbunden sein, seine Ansprüche durchzusetzen. Es liegt nämlich am Käufer, nachzuweisen, dass die Mängel nicht durch ihn selbst verursacht wurden – dies geschieht mit Hilfe eines Gutachtens. Da die Erstellung eines Gutachtens recht kostspielig ist, lohnt sich dies nur dann, wenn die Forderungen des Käufers dementsprechend hoch sind.
Generell gilt: Weigert sich der Verkäufer, Ihren Anspruch auf Garantie zu erfüllen, obwohl Ihnen dieser rechtmässig zustünde, können Sie von diesem Schadenersatz fordern.
Übrigens: Wurde Ihnen im Rahmen einer vertraglichen Garantie lediglich ein Anspruch auf Reparatur der Sache gewährt, muss dies auch seitens des Verkäufers erfüllt werden. Gelingt es ihm nach wiederholtem Versuch nicht, den Gegenstand zu reparieren, können Sie auf Ihre Gewährleistungsansprüche bestehen und einen Ersatz der Ware fordern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
Rechtliche Möglichkeiten bei Mängel
Hat man einen Mangel entdeckt, gilt es, diesen umgehend zu beanstanden, da die Ansprüche auf Garantie ansonsten als verwirkt gelten. So nicht bereits geschehen, sollte ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) bzw. den Kaufvertrag geworfen werden, um herauszufinden, welche Ansprüche im Einzelfall bestehen. Sind dort keine Bestimmungen zur Garantie zu finden, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. Um Ihre Ansprüche auf Gewährleistung bzw. Garantie geltend zu machen, sollten Sie folgendermassen vorgehen:
- Mängelrüge: Sobald Sie einen Mangel entdecken, ist dieser dem Verkäufer sofort zur Anzeige zu bringen. Aus Beweisgründen sollten Sie das am besten schriftlich und per Einschreiben tun. In dem Schreiben sollten Sie genau beschreiben, um welche Mängel es sich handelt.
- Ersatzlieferung, Wandelungsklage oder Minderungsklage: Generell können Sie selbst wählen, ob Sie vom Vertrag zurücktreten (Wandelung), die Ware durch eine neue ersetzen lassen oder als Ausgleich des Wertverlustes einen Teil des Kaufpreises zurückerhalten möchten (Minderung). Die Wahlmöglichkeiten können jedoch durch die AGB, den Kaufvertrag oder auch durch die konkrete Situation eingeschränkt sein. Teilen Sie dem Verkäufer in dem Schreiben mit, für welche dieser Optionen Sie sich entschieden haben.
- Schadenersatz: Treten Sie vom Vertrag zurück, hat der Verkäufer Ihnen den Kaufpreis samt Zinsen zurückzuerstatten. Zudem haben Sie Anspruch auf Rückerstattung der Prozesskosten und der Verwendungen und Schäden, die Ihnen durch die Lieferung fehlerhafter Ware unmittelbar verursacht wurden (zum Beispiel Versandkosten). Sollte Ihnen weiterer Schaden entstanden sein, haftet der Verkäufer nur im Falle seines Verschuldens dafür. Anspruch auf Schadenersatz kann auch geltend gemacht werden, wenn der Verkäufer die Garantie nicht erfüllt.
- Bei Reparatur: Müssen Sie monatelang auf den reparierten Gegenstand warten, sollten Sie den Verkäufer kontaktieren und ihm eine Frist von 2-3 Wochen setzen. Machen Sie den Verkäufer auch darauf aufmerksam, dass Sie – sollten Sie Ihren Gegenstand nach Ablauf der Frist noch nicht zurückerhalten haben – vom Kaufvertrag zurücktreten und Ihr Geld zurückfordern werden. Scheitert die Reparatur mehrmals, dann haben Sie ebenfalls das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder den Gegenstand durch einen neuen ersetzen zu lassen.
- Bei Ausschluss der Gewährleistung: Wurde die Gewährleistungspflicht vom Käufer in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ausgeschlossen, so besteht für den Käufer unter Umständen auch die Möglichkeit, dies anzufechten. Dem Verkäufer steht es zwar frei, die Garantie in den AGB anzupassen – dies jedoch nur, solange dadurch keine erhebliche und ungerechtfertigte Benachteiligung des Käufers entsteht.
Auch wenn dem Käufer eine gesetzliche oder vertragliche Garantie rechtmässig zusteht, kann es zu Schwierigkeiten mit dem Verkäufer kommen – etwa weil dieser nicht auf Ihre Kontaktversuche reagiert, seine Verpflichtung zur Garantie abstreitet oder den Kaufpreis nicht zurückerstattet. In solchen Fällen bleibt dem Kunden oft nichts anderes übrig, als seine Ansprüche auf dem Rechtsweg durchzusetzen. Hierbei empfiehlt es sich, juristische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die Vorgehensweise zu finden, die sich für Ihre persönliche Situation eignet.
Wie kann ein Anwalt für Vertragsrecht helfen?
In vielen Fällen lassen sich Ansprüche auf Garantie direkt beim Verkäufer einfordern, ohne dass weitere rechtliche Schritte nötig sind. Leider erleben auch nicht wenige Kunden Situationen, in welchen sich der Verkäufer weigert, die Garantie zu erfüllen. Die Probleme können vielgestaltig sein und die Gespräche mit dem Verkäufer aussichtslos erscheinen. Gerade für einen Laien können dabei grosse Unsicherheiten entstehen, sodass er schliesslich dazu bewegt wird, auf seine Ansprüche zu verzichten.
In einer Rechtsberatung stellt sich dann oftmals heraus, dass der Kunde sehr wohl berechtigte Ansprüche gegenüber dem Verkäufer hat. Gerade wenn hohe Geldsummen auf dem Spiel stehen, sollten Sie daher nicht locker lassen und wenn nötig einen Anwalt hinzuziehen. Dieser prüft Ihre Ansprüche und kann Ihnen gegebenenfalls helfen, diese vor Gericht durchzusetzen. Mit juristischer Unterstützung kann es im besten Fall auch gelingen, auf aussergerichtlichem Wege eine Einigung mit dem Verkäufer herbeizuführen. Rechtsstreitigkeiten lassen sich jedoch nicht immer vermeiden, besonders wenn der Verkäufer behauptet, dass der Käufer die Mängel selbst verursacht hat. Um dies vor Gericht glaubhaft zu machen ist anwaltliche Hilfe anzuraten.

FAQ: Garantie
Das Gesetz sieht eine Garantielaufzeit von mindestens 2 Jahren vor, für Occassionsverkäufe (zum Beispiel Gebrauchtwaren) gilt eine Frist von 1 Jahr. Die gesetzliche Garantiedauer gilt jedoch nicht für Käufe von Händler zu Händler. Ausserdem können die Garantiefristen durch den Kaufvertrag oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angepasst werden, die Garantie kann sogar gänzlich ausgeschlossen werden.
Durch die Garantie wird gewährleistet, dass Sie eine intakte Ware besitzen. Ist die Ware mangelhaft, können Sie von Gesetzes wegen wählen, ob Sie diese gegen eine neue eintauschen möchten, den Kauf rückgängig machen oder einen Teil des Kaufpreises zurückerhalten möchten, um den Wertverlust zu kompensieren. Des Weiteren kann auch Anspruch auf Schadenersatz bestehen.
Wenn alle Versuche gescheitert sind und der Verkäufer sich weigert, Ihre Ansprüche zu erfüllen, sollten Sie prüfen, ob es sich lohnt, gerichtlich dagegen vorzugehen. Bei Nichterfüllung der Garantie können Sie grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz geltend machen.

Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.